|
|

Verschiedenes
(c) FWTM-Stearlmedia | | | | | 50 Jahre Herbstmess’ | Freiburger Volksfest feiert Jubiläum vom 17. bis 27. Oktober
Die Freiburger Herbstmess’ blickt auf ein halbes Jahrhundert Tradition zurück: Vom 17. bis 27. Oktober 2025 lädt das beliebte Volksfest zum 50. Mal auf das Messegelände ein. Über 100 Schaustellerinnen und Schausteller sorgen mit Fahrgeschäften, Marktständen
und kulinarischen Angeboten fĂĽr Feststimmung bei Jung und Alt.
Jubiläumseröffnung mit Gratisfahrten und Fassanstich
Zum Auftakt am Freitag, 17. Oktober, erwartet die Besucherinnen und Besucher ein besonderes Highlight: Alle Fahr- und Belustigungsgeschäfte sind von 17:00 bis 17:30 Uhr kostenlos nutzbar – ein Geschenk der Schaustellerinnen und Schausteller zum 50. Jubiläum. Darüber hinaus werden Gutscheinblöcke im Gesamtwert von 20.000 Euro verlost. Jeder Gutscheinblock enthält einen Wert von 50 Euro und kann an zahlreichen Ständen und Fahrgeschäften eingelöst werden (solange der Vorrat reicht). Die feierliche Eröffnung erfolgt um 19:00 Uhr am Riesenrad, mit dem traditionellen Fassanstich durch Oberbürgermeister Martin Horn, begleitet vom Musikzug der Feuerwehr Freiburg.
Neu: Badisches Oktoberfest im Festzelt
Erstmals findet im Rahmen der Herbstmess’ das Badische Oktoberfest statt. An den Freitag- und Samstagabenden lädt das große Festzelt zu stimmungsvoller Live-Musik, regionalen Spezialitäten und geselliger Atmosphäre ein.
Attraktionen fĂĽr die ganze Familie
Auf dem Festgelände erwarten die Besucherinnen und Besucher beliebte Klassiker wie die Achterbahn „Wilde Maus“, das Laufgeschäft „Rio“, die Geisterbahn „Haunted Castle“, Break Dance, Flipper, Schwanenkettenflieger, Autoskooter sowie Kinderkarussells für alle Altersgruppen.
Das kulinarische Angebot reicht von Crêpes, Twister, Langosch, Pizza, Burgern und Grillspießen bis hin zur klassischen badischen Küche. Auf dem Warenmarkt laden hochwertige Lederwaren, Schmuck, Textilien, Gewürze und viele weitere Produkte zum Stöbern ein. Ein besonderes nostalgisches Erlebnis bietet die historische Straßenbahn, die an beiden Sonntagen zwischen Bertoldsbrunnen und Messegelände pendelt. Fahrzeiten und Details sind online auf der Website der Herbstmess’ abrufbar.
Aktionstage 2025 – Veranstaltungen im Überblick
Sonntag, 19. Oktober, 10:00 Uhr – Weißwurstfrühstück im Riesenrad
Dienstag, 21. Oktober – Kinder- und Familientag: Halbe Fahrpreise an allen Fahrgeschäften
Mittwoch, 22. Oktober – Studierendentag: Ermäßigungen gegen Vorlage des Studierendenausweises
Donnerstag, 23. Oktober – Schnäppchen- und Aktionstag: Losverteilung ab 17:00 Uhr, Verlosung um 21:00 Uhr am Riesenrad
Freitag, 24. Oktober – Oma-Opa-Enkeltag: Um 14:00 Uhr erhalten die ersten 150 Großeltern eine Geschenktüte mit einem „Messmogge“ und sieben Freikarten
Freitag, 24. Oktober – Seniorentag ab 14:00 Uhr im kleinen Festzelt bei Heiko Kurze: Kaffee, Kuchen, buntes Rahmenprogramm,
Gewinnspiel sowie Gutscheine für ein Getränk und eine „Lange Rote“
Montag, 27. Oktober – Großes Abschlussfeuerwerk zum festlichen Finale
Anpassung aus Verantwortung: Nur noch Abschlussfeuerwerk
Im Sinne einer ausgewogenen Veranstaltungsplanung und der zunehmenden ökologischen Verantwortung wird es bei der Freiburger Herbstmess’ in diesem Jahr nur noch ein Abschlussfeuerwerk
geben – das Eröffnungsfeuerwerk entfällt. Damit reagiert die FWTM sowohl auf den Wunsch vieler Anwohner*innen nach mehr Rücksicht auf Lärm, insbesondere im Hinblick auf Tiere, Familien mit kleinen Kindern und ältere Menschen, als auch auf ökologische Aspekte. Seit dem Umzug des Jahrmarkts auf den neuen Messplatz wurden zunächst bewusst zwei Feuerwerke angeboten, um die Besucherbindung am neuen Standort zu stärken. Inzwischen hat sich der neue Veranstaltungsort jedoch sehr erfolgreich etabliert, sodass diese Maßnahme nicht mehr erforderlich ist.
Den feierlichen Schlusspunkt der Jubiläumsausgabe der Herbstmess’ setzt am Montagabend, 27. Oktober, nach wie vor das große Abschlussfeuerwerk – als stimmungsvolles Highlight, das Tradition und Volkskultur auf verantwortungsvolle Weise miteinander verbindet.
Informationen & Kontakt
Weitere Informationen zur Freiburger Herbstmess’ 2025, Fahrpläne der Straßenbahn, Öffnungszeiten und Programmdetails sind online unter: www.freiburger-herbstmess.de | | | | | |
| Neueste Rebsorte "Sauvitage" (c) Sonnenbrunnenstrauße | | | | | Sonnenbrunnenstrausse Freiburg-Opfingen | Unsere Straußwirtschaft ist bis 26. Oktober geöffnet !!
Bei schönem Wetter auch draußen !
Donnerstags ab 18.00 Uhr, Freitags ab 17.00 Uhr
Samstags ab 17.00 Uhr, Sonntags ab 16.00 Uhr
Unsere Spezialitäten :
Neuer SĂĽsser und Zwiebelwaie
KĂĽrbissuppe mit Ingwer u. Kokosmilch
verschiedene Flammenkuchenvariationen
Sonnenbrunnenstrausse
Unterdorf 30 - 79112 Freiburg Opfingen - Tel.07664/59273 | | Mehr | | | |
| | | | | | Kulturbühne trifft Dunkelrestaurant: Rosenau Stuttgart | | Kulturprogramm und kulinarischer Genuss gehen in der ehemaligen Brauereigaststätte Rosenau im Stuttgarter Westen Hand in Hand, denn die Bühne liegt hier, wie früher oft üblich, im Gastraum. Wem das Angebot aus Kleinkunst, Comedy, Konzerten und Kulinarik zu wenig ist, dem sei das Dunkelrestaurant „aus:sicht“ empfohlen. Bei der Veranstaltungsreihe wird den Gästen in völliger Finsternis ein Mehrgang-Menü serviert, dessen Bestandteile es herauszuschmecken gilt. Neben dem Geschmacks- wird hier aber auch der Hörsinn bedient – mit einem Live-Kulturprogramm für die Ohren. | | Mehr | | | |
| Sunset-Picknick am Bodensee (c) Überlingen Marketing und Tourismus GmbH | | | | | Sundowner am See: Überlinger Picknick-Tour | | Wenn Augen- und Gaumenschmaus eine Liaison eingehen, sind genussvolle Erlebnisse garantiert. Der Bodensee bietet dafür die besten Voraussetzungen: Im milden Klima der Region gedeihen süßes Obst, knackiges Gemüse und feiner Wein. Dazu gesellen sich traumhafte Aussichten bis zu den Alpen. Mit dem Überlinger Picknick-Rucksack lässt sich die Region mit allen Sinnen erleben. Besonders in den Abendstunden, wenn die Sonne langsam im See versinkt und die Umgebung in magisches Licht taucht. | | Mehr | | | |
| Blick am Morgen vom Feldberg auf den Feldsee (c) Hochschwarzwald Tourismus GmbH | | | | | Gipfelglühen: Wanderung zum Sonnenaufgang auf dem Feldberg | | Ein einzigartiges Erlebnis erwartet Wanderinnen und Sonnenanbeter bei der Besteigung des Feldberggipfels in den frühen Morgenstunden. Los geht es auf leisen Sohlen, während die Täler noch schlafen. Mit der Dämmerung erwacht die Natur, bereit die ersten Sonnenstrahlen aufzunehmen. Am Gipfel heißt es dann warten, bis das Naturschauspiel beginnt und sich die Sonne langsam über den Horizont schiebt, um den Hochschwarzwald und die umliegenden Bergzüge mit ihrem Licht endgültig von der Nacht zu befreien. Bei Tagesanbruch darf dann auch eingekehrt und gefrühstückt werden, natürlich stilecht in einer urigen Hütte. Am 14. und 28. September und am 12. Oktober geht es zum Sonnenaufgang wieder hoch hinaus. | | Mehr | | | |
| (c) VMG, Vertriebs-Marketing-Gesellschaft mbH | | | | | Gutscheinbuch.de Schlemmerblock Freiburg & Umgebung 2025/2026 | Die neue Ausgabe ist erschienen – vor Ort und online sparen
Der Schlemmerblock ermöglicht den Genuss der besten kulinarischen Highlights und Freizeitaktivitäten in über 200 Regionen bundesweit. Die neue Auflage des erfolgreichsten Gastronomie- und Freizeitführers ist bis 1. Dezember 2026 gültig. Die Schlemmerblöcke bieten auch diesmal eine breite, kulinarische Auswahl an Gastronomien u.a. nach dem 2für1- sowie dem 4für2-Prinzip. Nicht nur Schlemmen ist angesagt: Spannende und abwechslungsreiche Freizeiterlebnisse sorgen für Spaß und Abwechslung für jedermann. Neben einer gustiösen Auswahl an Restaurants und angesagten Cafés finden Nutzer auch viele Angebote für Wellness-, Freizeit- und Sporteinrichtungen. Die bunte Mischung an Angeboten spricht jeden an.
Sparen – online und von zu Hause aus
Den eigenen Geldbeutel zu schonen ist immer eine gute Idee: Der Gutscheinbuch.de Schlemmerblock spricht nicht nur Restaurantbesucher und Kaffeegenießer mit attraktiven Angeboten an, sondern ermöglicht kulinarischen Genuss auch in den eigenen vier Wänden durch Gutscheine für Lieferung und Abholung.
In der neuen Gutschein-Kategorie „Online-Anbieter“ finden Sparfüchse weitere Rabattaktionen von namhaften Anbietern wie eismann, Hemden.de, NORMA24, Beurer, 3Bears, BLACKROLL, Lampenwelt und DeinDesign. Diese und viele weitere exklusive Online-Gutscheine können über den Block-Code, der direkt beim Aufschlagen eines Blockes sichtbar ist, auch von der heimischen Couch aus genutzt werden. In der Gutschein-Kategorie „Extra-Prozente“ sind zahlreiche vor Ort einlösbare Angebote enthalten.
Mit dem in jedem Block enthaltenen Guthaben von mindestens 30 € für Mobile-Gutscheine.de kann auf 8.000 digitale Gutscheine bundesweit zugegriffen werden.
Die Highlights aus Freiburg & Umgebung sind in der Auflage 2025/2026 u.a.:
• Wälder: Genuss Gastwirtschaft in Feldberg-Bärental
• Muße am See – Bio Asia Dining in Titisee-Neustadt
• Restaurant | Pizzeria Dreisamtalblick in Freiburg-Ebnet
• Markgräfler Winzerstuben in Badenweiler
• Isst Balance in Titisee-Neustadt
• Rätsel-Haft in Freiburg im Breisgau
• Kultur im Kino in Lenzkirch
• Kinder Galaxie in Freiburg – St. Georgen
2x genießen – 1x zahlen: Das simple Prinzip des Marktführers
Ein gemütliches Abendessen im Restaurant, ein Wellnesstag mit dem Partner, Actionspaß mit Freunden oder ein Familienausflug in den nächsten Freizeitpark: Neben zahlreichen 2für1-Angeboten profitieren auch Singles, Familien und Gruppen von den Gutscheinen. In teilnehmenden Restaurants und Cafés gibt es das zweite, gleichwertige oder günstigere Hauptgericht gratis, während man bei verschiedenen Freizeitangeboten bis zu 30 € sparen kann. Welcher Gastronom welche Regelung führt, lässt sich über die einfache Symbolik direkt auf den einzelnen Gutscheinen erkennen. Mit dem Gutscheinbuch.de Schlemmerblock kann auch ganz bequem zu Hause gespart werden, denn viele Anbieter gewähren bei Abholung oder Lieferung einen Rabatt. Meist hat sich die Anschaffung für den Nutzer bereits bei der zweiten Einlösung eines Gutscheins gelohnt. | | | | | |
| Sonnenuntergang auf dem Turmberg (c) KTG Karlsruhe Tourismus GmbH / Fabry | | | | | Chill-out im Abendrot: Turmberg Karlsruhe | | Der Turmberg bei Karlsruhe ist der nordwestlichste Gipfel des Schwarzwalds und grenzt an den Kraichgau. Erreicht werden kann er mit der Turmbergbahn, Deutschlands ältester noch in Betrieb befindlicher Standseilbahn, oder auf 528 Stufen über die "Hexenstäffele". Seine Aussichtsterrasse bietet einen spektakulären Blick über die Fächerstadt, das Rheintal und bei entsprechender Witterung sogar die Gipfel der Nordvogesen. Jeden Abend versammeln sich Einheimische wie Gäste dort auf den Terrassenstufen und genießen, wie die sinkende Sonne die Landschaft in ein magisches Licht taucht. Im Anschluss kann man den Tag im Hofbistro „Anders auf dem Turmberg“ ausklingen lassen. | | Mehr | | | |
| | | | | | Überraschung im Kaffeekapsel-Test | Qualität muss nicht teuer sein
Die Stiftung Warentest hat 17 Kaffeekapseln und -kugeln für sieben verschiedene Maschinensysteme u. a. von Tchibo, Nescafé und Tassimo getestet. Das erfreuliche Ergebnis: Gute Handelsmarken für Nespresso-Maschinen gibt es ab 17 Cent pro Kapsel. Die beste schlägt sogar knapp das fast dreimal so teure Originalprodukt.
Kaffeekapseln sind deutlich teurer geworden: Sie kosteten im Mai rund 12 Prozent mehr als im Vorjahr. Umso erfreulicher ist das Ergebnis der aktuellen Untersuchung der Stiftung Warentest: Verbraucher können bei Nespresso-kompatiblen Kapseln kräftig sparen. Wer vom teuren Original auf die günstigsten guten Kapseln im Test umsteigt, kann bei durchschnittlichem Konsum von vier Tassen täglich rund 500 Euro im Jahr weniger ausgeben. Die Qualitätsunterschiede zwischen günstigen Handelsmarken und teuren Nespresso-Originalkapseln sind minimal“, erklärt Swantje Waterstraat, Ernährungsexpertin bei der Stiftung Warentest.
Für die anderen sechs Systeme im Test gibt es dagegen kaum gute Kapseln. Das liegt nicht am Geschmack, sondern an besonders ressourcenverschwendenden Kapseln: Die von Lavazza, Nescafé Dolce Gusto, Tassimo und Netto Marken-Discount lassen sich nicht oder nur teilweise recyceln.
Geschmacklich ähneln sich alle Kapselkaffees im Test für Lungo oder Caffè Crema stark – eine Tendenz zum Einheitsgeschmack. Schadstoffe fanden die Tester meist nur in unbedenklichen Mengen, lediglich die teuersten Kapseln von Cup Verde (53 Cent) waren deutlich mit Schimmelpilzgift belastet. Den gesetzlichen Höchstgehalt halten sie zwar ein, besser wäre es trotzdem, wenn die Kapseln das Gift gar nicht enthielten.
Welche Handelsmarken es auf das Siegertreppchen geschafft haben und was von kompostierbaren Kapseln zu halten ist, steht in der September-Ausgabe der Stiftung Warentest und unter www.test.de/kaffeekapseln. | | Mehr | | | |
|
Seite 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46
47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69
70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92
93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115
116 117 118
|
|
|
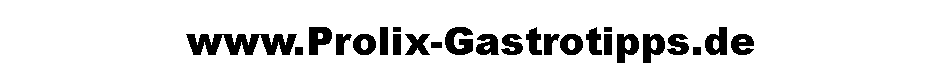



.jpg)

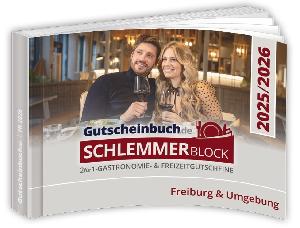
.jpg)
